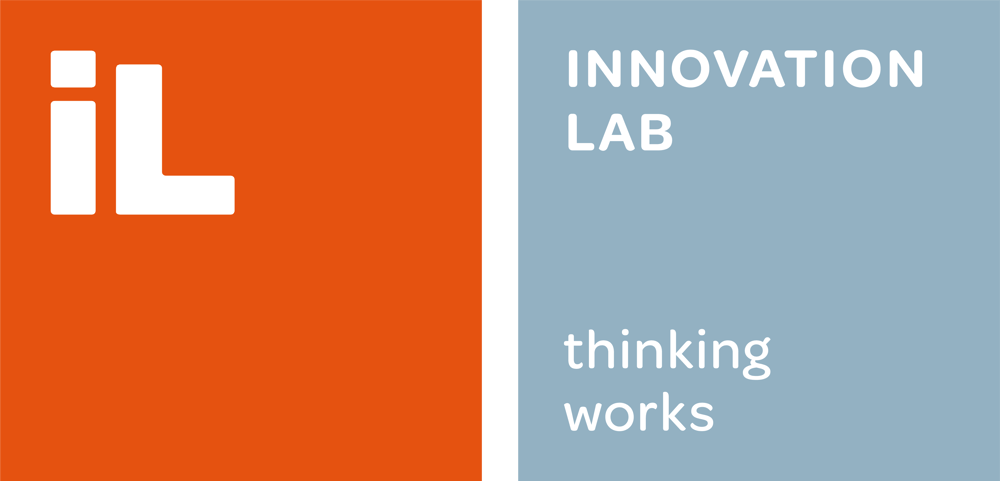iL‒AKTUELL
15. April 2025
Elena Kromidas vom 3R‒Center:
„Beobachten eine starke Dynamik“
Dr. Elena Kromidas hat seit 15. August 2024 die Leitung der Geschäftsstelle des 3R‒Centers Tübingen für In‒vitro‒Modelle und Tierversuchsalternativen übernommen. Mit ihrer umfassenden wissenschaftlichen Expertise im Bereich Mikrophysiologischer Systeme (MPS) und internationalen Forschungserfahrung treibt Elena Kromidas die Entwicklung und den Fortschritt im Bereich der Ersatz‒ und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen in Tübingen weiter voran.
Beim iL‒Workshop „Organ‒on‒Chip“ am 29. April wird sie die Keynotespeakerin sein. Im Interview berichtet sie, warum es sich lohnt, den Dialog zwischen wichtigen Interessensgruppen zu fördern.
Frau Kromidas, was motiviert Sie, die Keynote beim InnovationLab‒Workshop „Organ‒on‒Chip“ in Heidelberg zu halten?
Elena Kromidas: Ich freue mich sehr, die Keynote beim iL Life Science Tech Day zu halten, da diese Veranstaltung die wichtigsten Akteure zusammenbringt, die Innovationen in der Organ‒on‒Chip (OoC)‒Technologie und der personalisierten Medizin vorantreiben. Die Kombination aus Wissenschaft, Industrie und Technologieanbietern ist genau das, was wir brauchen, um OoC‒Technologien voranzutreiben. Dieses Feld entwickelt sich rasant, und Zusammenarbeit ist unerlässlich, um die aktuellen Herausforderungen wie Skalierbarkeit, Standardisierung und Technologietransfer zu meistern. Die Infrastruktur von iL bietet ein ideales Umfeld für solche Kooperationen, und ich freue mich auf den Austausch mit anderen Experten, um die Einführung von OoC in der Arzneimittelentwicklung und Krankheitsmodellierung zu beschleunigen.
OoC hat sich in der Forschung als Ersatz und Ergänzung für Tierversuche erwiesen. Wann werden wir keine Experimente mit Mäusen und Ratten mehr benötigen?
Kromidas: Obwohl OoC‒Technologien erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung des Bedarfs an Tierversuchen erzielt haben, ist die vollständige Eliminierung von In‒vivo‒Modellen weiterhin ein langfristiges Ziel. Der Übergang hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der regulatorischen Akzeptanz, der Qualifizierung und Validierung von OoC‒Modellen für ein breites Anwendungsspektrum sowie der Fähigkeit, komplexe Organinteraktionen zu replizieren. Wir beobachten eine starke Dynamik, da Initiativen wie der FDA Modernization Act 2.0 Alternativen zu Tierversuchen anerkennen. Für einen vollständigen Ersatz sind jedoch weitere Fortschritte bei Standardisierung, Skalierbarkeit und Multiorganintegration erforderlich. Wenn Forschung, Regulierungsbehörden und Industrie weiterhin zusammenarbeiten, könnten wir in den nächsten Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel erleben.
Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass die Organ‒on‒Chip (OoC)‒Technologie nicht nur Tierversuche ersetzen oder reduzieren soll, sondern auch ein erhebliches Potenzial als komplementärer Ansatz bietet. Sie kann Forschungsfragen beantworten, die mit Tiermodellen nicht beantwortet werden können. Beispielsweise können OoC‒Systeme strategisch kombiniert werden, um komplexe Interaktionen zwischen Organen zu untersuchen, oder in Studien eingesetzt werden, die humanspezifische Reaktionen erfordern. Dies ist insbesondere bei der Untersuchung des Immunsystems relevant, welches sich bei Mensch und Tier deutlich unterscheidet. Darüber hinaus eröffnet die OoC‒Technologie spannende Möglichkeiten in der personalisierten Medizin und ermöglicht die schnelle und skalierbare Entwicklung patientenspezifischer Modelle. Dies ermöglicht eine genauere Vorhersage individueller Reaktionen auf Behandlungen und trägt letztlich zur Entwicklung sichererer und wirksamerer Therapien bei.

Dr. Elena Kromidas vom 3R‒Center Tübingen: „Die OoC‒Technologie eröffnet spannende Möglichkeiten in der personalisierten Medizin und ermöglicht die schnelle und skalierbare Entwicklung patientenspezifischer Modelle.“ Bild: 3R‒Center
Leitprinzip: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“
Sie bauen im 3R‒Center Tübingen eine Core Facility für mikrophysiologische Systeme auf. Welche technologischen Herausforderungen müssen Forschung und Wirtschaft gemeinsam bewältigen?
Kromidas: Eine große Herausforderung für die Forschung besteht in der Auswahl der am besten geeigneten Technologien und Modelle. Dazu gehört die Wahl zwischen etablierten oder kommerziell verfügbaren Plattformen, Biomaterialien, Zelltypen und ‒quellen sowie die Festlegung des Grads der biologischen Komplexität. Unser Leitprinzip lautet: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, denn höhere Komplexität bedeutet auch mehr Zeit, Kosten und Fachwissen. Dieser Auswahlprozess erfordert interdisziplinäres Know‒how und eine sorgfältige Abwägung von wissenschaftlicher Relevanz und Machbarkeit. Parallel dazu entwickeln wir Schulungskonzepte und ‒materialien, um den Wissenstransfer zu erleichtern, bevor Wissenschaftler die MPS in den bereitgestellten Laboren betreiben.
Auf der geschäftlichen und operativen Seite werden wir derzeit durch eine Anschubfinanzierung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden‒Württemberg (MWK) unterstützt. Wir entwickeln derzeit ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Dazu gehören die Anschaffung der notwendigen spezialisierten Infrastruktur, die Ausarbeitung einer klaren Nutzungsrichtlinie und die Schaffung eines robusten Betriebsrahmens, um einen einfachen und niedrigschwelligen Zugang für die Nutzer zu gewährleisten.
Gibt es erfolgreiche Implementierungen, wie beispielsweise humane Gewebemodelle für Gebärmutterhalskrebs, in der Industrie und im klinischen Alltag?
Kromidas: Humane Gewebemodelle wie Organoide und Organ‒on‒Chip‒Systeme (OoC) finden zunehmend Eingang in die Industrie, insbesondere in die Krankheitsmodellierung und die Arzneimittelentwicklung. Aufgrund ihrer voraussichtlich höheren Übertragbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Tiermodellen besteht großes Interesse an humanbasierten Modellen, und viele Pharmaunternehmen investieren aktiv in diesen Bereich. Auch in der klinischen Praxis zeichnen sich erste Anwendungen ab, beispielsweise werden patientenbasierte Organoide zur Unterstützung personalisierter Behandlungsentscheidungen in der Onkologie eingesetzt. Obwohl diese Modelle noch nicht zum Standard gehören, versprechen sie vielversprechende Fortschritte in der Präzisionsmedizin und gewinnen sowohl im regulatorischen als auch im translationalen Kontext zunehmend an Anerkennung.
Derzeit werden Gebärmutterhalskrebs‒on‒Chip‒Modelle vor allem in der Forschung und weniger in der Industrie oder klinischen Praxis eingesetzt. Jüngste Studien haben fortschrittliche mikrofluidische Plattformen zur Modellierung von 3D‒Gebärmutterhalskrebsgewebe einschließlich der Tumormikroumgebung entwickelt. Diese ermöglichen die Untersuchung des Tumorverhaltens und potenzieller therapeutischer Interventionen und legen den Grundstein für die personalisierte Medizin. Obwohl diese Modelle vielversprechend für zukünftige Anwendungen sind und zunehmend in die Grundlagenforschung integriert werden, sind sie noch nicht in routinemäßige industrielle Prozesse oder klinische Arbeitsabläufe integriert. Weitere Forschung und Validierung sind notwendig, bevor solche Modelle in diesen Sektoren breiter eingesetzt werden können.

Beliebtes Netzwerktreffen: Elena Kromidas bei der 3R‒Network Baden‒Württemberg Annual Conference 2025 Anfang April auf dem Campus in Vaihingen der Universität Stuttgart. Bild: 3R‒Center
Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema OoC um?
Kromidas: Die erfolgreiche und konsequente Implementierung humanbasierter Ersatz‒ und Komplementärmethoden wie OoC erfordert, dass alle relevanten Akteure a) durch Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit auf diese Innovationen aufmerksam gemacht, b) entsprechend geschult und beraten und c) mit einfachem Zugang zur notwendigen Infrastruktur und Expertise ausgestattet werden. Im 3R‒Zentrum verfolgen wir genau diesen ganzheitlichen Ansatz mit unseren drei Säulen: Information, Aus‒ und Weiterbildung sowie direkte Forschungsunterstützung. Nur wenn wir all diese Aspekte gleichzeitig berücksichtigen, können wir den Übergang zu humanrelevanteren, ethischen Forschungsmethoden beschleunigen.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Zugänglichkeit und der Maximierung des Potenzials von OoC, Tierversuche möglichst zu ersetzen. Mit der Entwicklung unserer Core Facility für mikrophysiologische Systeme konzentrieren wir uns darauf, die vorhandene Infrastruktur und Expertise zu nutzen, um diese Technologien Wissenschaftlern breiter zugänglich zu machen. Ein zentrales Ziel ist es, Tierversuche dort zu ersetzen, wo sie bereits möglich sind. Dies erfordert eine klare Definition des Anwendungskontexts, das heißt die Identifizierung spezifischer Szenarien, in denen OoC‒Modelle zuverlässige und reproduzierbare Alternativen zu In‒vivo‒Experimenten bieten können. Indem wir auf dem Vorhandenen aufbauen und kontinuierlich Erfahrungen sammeln, können wir die Anwendung von OoC‒Modellen weiter verfeinern und erweitern sowie die regulatorische Akzeptanz erhöhen. Durch Standardisierung, Validierung und die Zusammenarbeit mit der Industrie und Regulierungsbehörden können wir den Übergang zu ethischeren und humanrelevanteren Testmethoden beschleunigen.
Wie groß ist für das 3R‒Center als mikrofluidische Forschungsplattform Ihr Bedarf an Technologietransfer und Austausch beim iL‒Workshop?
Kromidas: Obwohl sich das 3R‒Zentrum Tübingen nicht auf die Erforschung und Entwicklung neuer Modelle konzentriert – diese Arbeit wird vom µOrganoLab, der Forschungsgruppe von Peter Loskill an der Universität Tübingen und dem Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI), durchgeführt – möchten wir über unsere MPS Core Facility eine Plattform bieten, auf der Wissenschaftler auf diese Technologien zugreifen und sie anwenden können. Der iL‒Workshop ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, den Dialog zwischen wichtigen Interessensgruppen wie Modellentwicklern, Modellnutzern, Technologieanbietern und Regulierungsexperten zu fördern. Dieser Austausch ist entscheidend, um Erwartungen abzugleichen, Lücken zu identifizieren und die praktische Umsetzung von OoC‒Modellen in der Forschung zu beschleunigen. Er hilft uns auch, die Bedürfnisse der Nutzer und die Richtung der technologischen Entwicklung besser zu verstehen, was wiederum die Gestaltung unserer Support‒Services und unserer Infrastruktur beeinflusst. Letztendlich verstehen wir uns als Vermittler in einem wachsenden Ökosystem, das dazu beiträgt, die verschiedenen Akteure zu vernetzen und zu befähigen und den Übergang zu humanrelevanten und tierversuchsfreien Forschungsmethoden voranzutreiben.
Zur Person
Dr. Elena Kromidas ist Wissenschaftlerin und engagiert sich für die Förderung der 3R‒orientierten Forschung mit Spezialisierung auf Organ‒on‒Chip‒Technologien (OoC). Sie studierte Technische Biologie an der Universität Stuttgart und fertigte ihre Masterarbeit an der Harvard Medical School an, wo sie den Proteinabbau durch das Proteasom untersuchte. Ihre Expertise in CRISPR‒Cas9‒Technologien vertiefte sie während ihrer Zeit bei Boehringer Ingelheim und trug zur Target Discovery bei.
In ihrer Promotion konzentrierte sich Elena Kromidas auf die Frauengesundheit und die Entwicklung von OoC am µOrganoLab unter der Leitung von Prof. Peter Loskill. Ihre Forschung umfasste die Entwicklung einer mikrofluidischen Plattform und von Gewebemodellen für den menschlichen Gebärmutterhals, einschließlich zervikaler intraepithelialer Neoplasien und Gebärmutterhalskrebs.
Seit August 2024 leitet Elena Kromidas den Geschäftsbereich des 3R‒Centers Tübingen. Ihre Mission ist der Aufbau und Betrieb einer Core Facility für mikrophysiologische Systeme, um humanrelevante In‒vitro‒Modelle für Forscher zugänglicher zu machen. Mit dieser Arbeit unterstützt sie den Übergang zu einer ethischeren, effektiveren und am Menschen orientierten biomedizinischen Forschung, indem sie die Abhängigkeit von Tierversuchen reduziert.
Über das 3R‒Center Tübingen
Das 3R‒Center Tübingen ist ein interdisziplinäres Forschungszentrum der Universität Tübingen und des NMI Reutlingen, das sich der Entwicklung und Anwendung humanrelevanter In‒vitro‒Modelle verschrieben hat. Ziel ist es, Tierversuche durch wissenschaftlich fundierte Alternativen zu ersetzen oder zu ergänzen – im Sinne der 3R‒Prinzipien (Replace, Reduce, Refine).
Im Fokus stehen mikrophysiologische Systeme (MPS), die komplexe menschliche Organfunktionen im Labor abbilden können und neue Perspektiven für die biomedizinische Forschung, Wirkstoffentwicklung und personalisierte Medizin eröffnen. Mit seiner Core Facility unterstützt das Zentrum Forschende durch Zugang zu innovativer Technologie, methodischer Beratung und gezielter Weiterbildung.
Das Interview führte Joachim Klaehn
Informationen zum LIFE SCIENCE TECH DAY
Weitere Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung gibt es auf unserer Webseite unter
https://www.innovationlab.de/life‒science‒tech‒day‒2025
Die Registrierung endet am 22. April, eine Woche vor dem Workshop am 29. April. Für Catering ist in den Räumlichkeiten „iL.Connect.Space“ von InnovationLab gesorgt.

Diese Website ist nicht Teil der Facebook-Website oder von Facebook Inc. Darüber hinaus wird diese Website in keiner Weise von Facebook unterstützt. Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc. Wir verwenden auf dieser Website Remarketing-Pixel/Cookies von Google, um erneut mit den Besuchern unserer Website zu kommunizieren und sicherzustellen, dass wir sie in Zukunft mit relevanten Nachrichten und Informationen erreichen können. Google schaltet unsere Anzeigen auf Websites Dritter im Internet, um unsere Botschaft zu kommunizieren und die richtigen Personen zu erreichen, die in der Vergangenheit Interesse an unseren Informationen gezeigt haben.